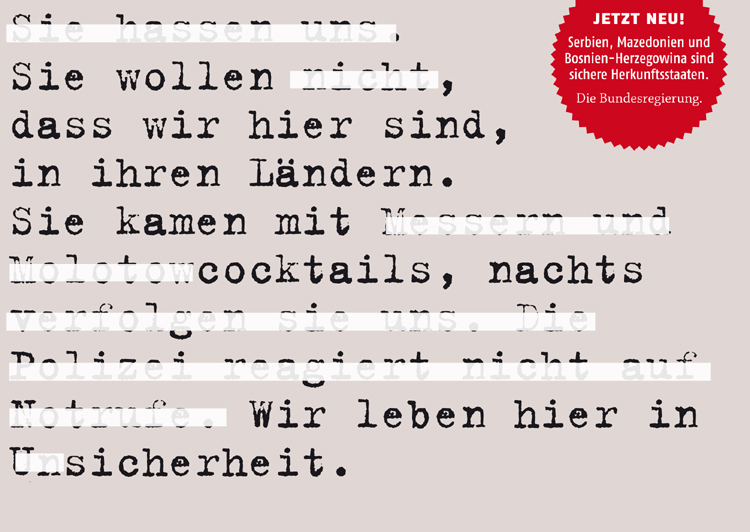In den vergangenen beiden Wochen konnten Interessierte im Rahmen des Vortragsprogramms „Armut, Ausgrenzung, Leistungszwang“ des AStA der Uni Konstanz erneut zwei spannende Vorträge erleben, die sich mit zentralen Fragen des gesellschaftlichen Lebens beschäftigten: Sandro Philippi, Vorstandsmitglied im Freien Zusammenschluss von Studierendenschaften (fzs) unterzog am 30. Oktober in seinem Referat „Boutiquen oder Räume für Wissenschaft und Bildung?“ die aktuellen Verhältnisse an Hochschulen einer „praxisorientierten Untersuchung”; in der folgenden Woche ging Lothar Galow-Bergmann, ehemals Personalrat des Klinikum Stuttgart und heute Publizist für Jungleworld, konkret und emafrie.de der Frage nach „Was ist eigentlich Kapitalismus?“ und versuchte zu erläutern „warum die Politik die Krise nicht stoppen kann“. Beide Vorträge zeigten eindrucksvoll auf, wie weit marktwirtschaftliche Verwertungsmechanismen in verschiedenste soziale Zusammenhänge vordringen und den öffentlichen Diskurs immer mehr bestimmen.
In den vergangenen beiden Wochen konnten Interessierte im Rahmen des Vortragsprogramms „Armut, Ausgrenzung, Leistungszwang“ des AStA der Uni Konstanz erneut zwei spannende Vorträge erleben, die sich mit zentralen Fragen des gesellschaftlichen Lebens beschäftigten: Sandro Philippi, Vorstandsmitglied im Freien Zusammenschluss von Studierendenschaften (fzs) unterzog am 30. Oktober in seinem Referat „Boutiquen oder Räume für Wissenschaft und Bildung?“ die aktuellen Verhältnisse an Hochschulen einer „praxisorientierten Untersuchung”; in der folgenden Woche ging Lothar Galow-Bergmann, ehemals Personalrat des Klinikum Stuttgart und heute Publizist für Jungleworld, konkret und emafrie.de der Frage nach „Was ist eigentlich Kapitalismus?“ und versuchte zu erläutern „warum die Politik die Krise nicht stoppen kann“. Beide Vorträge zeigten eindrucksvoll auf, wie weit marktwirtschaftliche Verwertungsmechanismen in verschiedenste soziale Zusammenhänge vordringen und den öffentlichen Diskurs immer mehr bestimmen.
Wenn alle im selben Boot sitzen: Die kapitalistische Verwertungslogik
Die Grundlage für diesen Prozess sieht Galow-Bergmann in einer entscheidenden Eigenschaft des marktwirtschaftlichen Systems, die häufig missverstanden werde: Die Tatsache, dass im Grunde jeder Mensch, der in einer modernen Industriegesellschaft lebt, Teil des volkswirtschaftlichen „Humankapitals“ ist und mit seinen vielfältigen Interessen, allen voran seiner Existenzsicherung, auf Gedeih und Verderb in das Gesamtsystem eingebunden ist. Es entsteht eine Verflechtung mit dem allgemeinen Wirtschaftskreislauf, durch die zwangsläufig der im klassischen Antikapitalismus konstatierte Gegensatz von Arbeitern und Kapitalbesitzern abgeschwächt wird.
Zwar leiden heute immer mehr Menschen auch in den westlichen Wohlfahrtsstaaten unter den sozialen Missständen, die ein neuerlich entfesselter Kapitalismus mit sich bringt. So weist die Bundesregierung selbst einen Anstieg des Anteils der BürgerInnen in Deutschland, die an oder unter der offiziellen Armutsgrenze leben müssen, von 12,7% im Jahr 2002 auf rund 15% im Jahr 2013 aus. Mehr als eine Million von Ihnen sind Kinder, hinzu kommt eine wachsende Altersarmut. Nichtsdestotrotz, so Galow-Bergmann, haben diejenigen Arbeitnehmer, welche nicht solchermaßen als monetär „wertlos“ vom Arbeitsmarkt aussortiert wurden, aus Sorge um ihren Lebensstandard ein grundlegendes Interesse am reibungslosen Funktionieren des kapitalistischen Systems. Es können kaum noch klare Feindbilder entwickelt werden, in denen „die da oben“ gegen „wir hier unten“ stehen, weil jeder, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, letzten Endes der Logik des abstrakten Verwertungsprinzips unterworfen ist. Dieses Prinzip herrscht weltweit, und seine praktische alltägliche Erscheinungsform ist das Geld.
Dessen Vermehrung, die Profitmaximierung in der wirtschaftlichen Tätigkeit, kann nur gelingen, wenn immer mehr Waren produziert und verkauft werden, während die Rationalisierung immer schneller voranschreitet. Die Notwendigkeit immer währenden Wachstums ist dieser Systemlogik immanent, mit all seinen negativen Folgen: Während einerseits immer mehr Menschen unter psychischen und körperlichen Belastungen am Arbeitsplatz klagen und am liebsten so früh wie möglich „raus aus dem Hamsterrad“ wollen, herrscht andererseits millionenfache Arbeitslosigkeit. Während einerseits vollmundige Versprechen von einem neuen „grünen Wachstum“ gemacht werden, gilt dennoch weiterhin, was ein BMW-Vorstand schon Anfang der 80er Jahre gesagt hat: “Es mag auf der Welt zu viele Autos geben, so gibt es dennoch zu wenig BMW!” Seine Beschäftigten würden ihm sicher auch heute noch zustimmen, eingedenk der Tatsache, dass ein Ende gerade dieses Wachstums ihre Arbeitsplätze in Gefahr bringen würde.
Allerdings steht dieses System laut Galow-Bergmann seit den 70er Jahren einer besonderen Herausforderung gegenüber: Mit einer explosionsartigen Steigerung der Produktivität durch die Entwicklung der Mikroelektronik fällt es dem Kapital weltweit immer schwerer, noch neue Wachstumspotentiale zu entwickeln. Zwar bot sich den nach Investitionsmöglichkeiten suchenden Vermögen in Gestalt der ebenfalls rasant wachsenden Finanzmärkte eine zeitweilig lukrative Anlagemöglichkeit. Diese brachte aber schon bald neue katastrophale Folgewirkungen für die Gesellschaften hervor, wie die in den 80er Jahren einsetzende Privatisierungswelle und der Weltfinanzkrise, die seit dem Jahr 2008 anhält. Inwiefern es gelingen kann, das weltwirtschaftliche System nach diesem Absturz wieder dauerhaft zu stabilisieren, bleibt noch abzuwarten; dass allerdings die selbstzerstörerische Tendenz des Kapitalismus ohne einen grundlegenden Wandel der Wirtschaftsweise selbst überwunden werden kann, steht nicht zu hoffen.
Emanzipationsanspruch ade: Der Wettbewerbsdruck in Bildung und Forschung
Mit diesem Wissensfundus im Hintergrund wird verständlich, dass das moderne Wissenschafts- und Hochschulwesen, über das Sandro Philippi referierte, nur ein Schauplatz der fortschreitenden Kommerzialisierung darstellt, der nichtsdestotrotz eine besondere Aufmerksamkeit verdient. „In der allgemeinen Wirtschaftskrise erscheint die Wissenschaft als eines der zahlreichen Elemente des gesellschaftlichen Reichtums, das seine Bestimmung nicht erfüllt. […] In dem Maß, als an die Stelle des Interesses für eine bessere Gesellschaft… das Bestreben trat, die Ewigkeit der gegenwärtigen zu begründen, kam ein hemmendes und desorganisierendes Moment in die Wissenschaft,“ erläuterte bereits Max Horkheimer im Jahr 1932, und aus Philippis Sicht hat diese Perspektive nichts an Aktualität eingebüßt. Wissenschaft und Bildung mögen seit der Zeit der Aufklärung das Versprechen in sich tragen, BürgerInnen zur gesellschaftlichen Emanzipation und Selbstbestimmung zu führen. Ob sie dieses Versprechen auch tatsächlich einlösten, sei jedoch mehr als fraglich. Vor allem eine notwendige Reflexion der Wissenschaft über ihre Stellung im Verhältnis zur Gesellschaft und Ökonomie vermisse man. Dabei sei diese notwendiger denn je, was eine Betrachtung der hochschulpolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte erweist.
Eine aktive Hochschulpolitik in der alten Bundesrepublik begann eigentlich erst in den 1960er und 70er Jahren, als bildungspolitische Reformen an den finanziellen und demokratischen Grundlagen des deutschen Universitätssystems ansetzten. Man verfolgte dabei sowohl politische als auch ökonomische Ziele: So wurde die Dominanz der Ordinarien, d.h. der Professoren und des Rektors, die bisher die Universitätsverwaltung bestimmt hatten, durch die demokratische Partizipation von Studierenden und der Mitarbeiter des akademischen Mittelbaus eingeschränkt; gleichzeitig wurde die finanzielle Ausstattung der Universitäten gestärkt und aufseiten der Studierenden das BAföG eingeführt. Man erhoffte sich durch eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen positive Rückwirkungen auf die Volkswirtschaft als Ganzes.
Diese hoffnungsvollen Ansätze trafen jedoch schon bald auf Schwierigkeiten. So wurde die anvisierte Drittelparität von Studierenden, Professoren und akademischem Mittelbau in der demokratischen Entscheidungsfindung an Hochschulen 1973 vom Bundesverfassungsgericht insoweit eingeschränkt, als es die Vorgabe aufstellte, Professoren auch weiterhin in allen wichtigen Angelegenheiten eine Mehrheit von mindestens 51 % einzuräumen. Bereits ein Jahr zuvor hatte das Gericht im sogenannten „NC-Urteil“ eine bedeutende hochschulpolitische Entscheidung gefasst und festgestellt, dass grundsätzlich alle BürgerInnen mit Hochschulzugangsberechtigung Anspruch auf einen Studienplatz hätten. Aus Kapazitätsgründen könne nur auf Grundlage einer Zuteilung nach einheitlichen Kriterien der Hochschulzugang rationiert werden, was sich in der Einführung des NC-Systems niederschlug. Die praktische Notwendigkeit für einen solchen eingeschränkten Bildungszugang sollte bereits 1977 augenfällig werden, als infolge einer zunehmenden Überlast an Studierenden die steigenden Hochschulfinanzen eingefroren wurden. Da die Universitäten jedoch weiterhin für alle Studierenden geöffnet blieben, kam diese Maßnahme über Jahrzehnte einer realen Kürzung der Hochschulfinanzierung infolge von Verschleiß und Inflation gleich.
Philippi merkt dabei an, dass die volkswirtschaftlichen Produktivitätszuwächse, von denen bereits oben die Rede war, nicht mehr die Universitäten erreichten. Stattdessen wurde die Universitätslandschaft durch verschiedene Mechanismen zunehmend dem Wettbewerb unterworfen. Im Zentrum standen dabei ein neuer mikroökonomischer Blickwinkel auf die Hochschule als ein zu managendes Unternehmen und eine Philosophie, nach der jedes Individuum selbst die Verantwortung für seine eigene Hochschulkarriere übernehmen sollte (die „Humankapitaltheorie“). Gleichermaßen zur Festigung dieser Ideologie wie zur Rechtfertigung der neuen Sachzwänge, denen die Hochschulen ausgesetzt wurden, begann man, die Methoden der Hochschulfinanzierung unter wettbewerblichen Gesichtspunkten neu zu gestalten.
So nahm die Höhe der Drittmittel in den Budgets der Universitäten sprunghaft zu, von rund 1 Milliarde DM 1975 auf 5,9 Milliarden € 2010. Über die Verwendung dieser außeretatmäßigen Finanzmittel, die etwa von der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder Privatunternehmen eingeworben werden, entscheidet seit 1985 der jeweilige Lehrstuhlinhaber ohne Beteiligung demokratischer Gremien der Hochschule, was einerseits die an den Projekten arbeitenden WissenschaftlerInnen in ein Abhängigkeitsverhältnis zum Lehrstuhlinhaber setzt, andererseits die Gefahr der Intransparenz gegenüber der universitären und allgemeinen Öffentlichkeit erhöht. Darüber hinaus bedeutet eine steigende Drittmittelquote eine zunehmende Einflussnahme privater Interessen auf öffentliche Hochschulforschung.
Ein weiteres Instrument, die leistungsorientierte Mittelvergabe, setzt statistische Kennziffern ein, um anschließend eine Zuteilung von Finanzmitteln an die einzelnen Hochschulen festzulegen. Auf diese Weise werden recht starre quantitative Vorgaben gemacht, die nicht unbedingt etwas über den gesellschaftlichen Mehrwert der betriebenen Forschung aussagen müssen. In ein ähnliches Horn bläst die berüchtigte Exzellenzinitiative, bei der eine Umverteilung von allgemeinen Hochschulmitteln auf eine kleine ausgewählte Elite im Vordergrund steht. Anstatt den qualitativen Abstand zwischen einzelnen Hochschulstandorten zu verringern, verstärkt man durch solche an ökonomischer Verwertbarkeit der Forschung orientierten Ansätze die Hierarchisierung der Hochschullandschaft, was wiederum als Legitimation für die Bevorzugung der „Besten“ in der nächsten Förderrunde herhalten muss.
Ergänzt werden diese finanziellen Mechanismen durch eine Stärkung der Alleinentscheidungskompetenzen der Hochschulrektorate etwa über einen einzigen Globalhaushalt und durch Änderungen in der Studienordnung. Während der politische Spuk der Studiengebühren wohl in Deutschland vorläufig beendet ist, bestehen immer noch weitere Zugangsbeschränkungen wie Verwaltungsgebühren und Auswahlverfahren für einzelne Studiengänge. Der Bologna-Prozess und die Einführung des BA- und MA-Systems dienten in diesem Kontext dazu, durch Verkürzung von Studienzeiten weitere Finanzmittel einzusparen und mit der Rationierung der Master-Studienplätze eine weitere Zugangshürde einzuziehen.
Die Alternative: Kritische Reflexion und Selbstorganisation
Sandro Philippi sieht trotz dieser alarmierenden Entwicklungen aktuell allerdings nur einen geringen Mobilisierungsgrad der Studierenden und Mitarbeitern an deutschen Universitäten. Ob dafür der ständige Zwang zur Selbstvermarktung, welcher kritisches Denken unter den Betroffenen allzu leicht verdrängt oder eine Denkhaltung, die eine grundsätzlich Trennung von Arbeit bzw. Ausbildung und Politik befürwortet, die Verantwortung trägt, lässt sich nicht leicht feststellen. Dass ein stärkeres Engagement der gesamten Studierendenschaft aber wünschenswert wäre, um die notwendige Debatte über Kommerzialisierung von Bildung und Wissenschaft anzustoßen, steht jedoch fest.
Demgegenüber möchte Lothar Galow-Bergmann bereits bei den gedanklichen Grundlagen einer verbreiteten Indifferenz gegenüber den fatalen Entwicklungen im kapitalistischen System ansetzen. Er spricht dabei von einem Gedankengefängnis, das die eigene Vorstellungskraft bei der Suche nach Alternativen zum jetzigen Wirtschaftssystem einschränkt: Anstatt sich in den Begriffen des Kapitalismus etwa durch die angeblich fehlende Finanzierungsgrundlage öffentlicher Einrichtungen wie Schwimmbäder einschüchtern zu lassen, sei es angebracht, sich vor Augen zu führen, dass die volkswirtschaftliche Produktivität und der physische Reichtum sehr wohl vorhanden sind, um gesellschaftlich sinnvollen Mehrwert zu schaffen. Engagierte Ansätze gibt es bereits, wenn z.B. Studierende an der Berliner Humboldt-Universität abseits der regulären Vorlesungen eine eigene Volkswirtschaftslehrstunde organisieren, weil sie davon überzeugt sind, dass die offizielle VWL ihnen keine Antworten auf ihre Fragen nach den krisenhaften Eigenschaften der Marktwirtschaft geben kann. Oder wenn sich an vielen Orten immer mehr Gruppen der Sharing Economy, der neuen Tauschwirtschaft bilden, die Güterverteilung abseits des Marktmechanismus organisieren.
Es kommt Galow-Bergmann darauf an, dass jeder neue Ansatz unbedingt auf der Selbstorganisation von Individuen abseits traditioneller politischer Führungsstrukturen beruhen soll. Wenn eine neue Bewegung hin zu einer Überwindung kapitalistischer Verwertungslogik entstehe, dürfe sie sich weder durch den Irrweg oberflächlicher Kapitalismuskritik noch durch die behauptete Alternativlosigkeit des aktuellen Gesellschaftsmodell verwirren lassen. Denn nur wenn der Glaube an unbewiesene Leitsätze der Wettbewerbsgesellschaft – wie etwa: der Mensch lasse sich grundsätzlich von Egoismus leiten – überwunden werden kann, stehen die Türen zu einer neuen Form des sozialen Zusammenlebens offen.
Konstantin Eisel